Panorama
Die Rennpappe namens Trabi erwacht wieder zum Leben
Andreas Hummel (dpa)
Mo, 04. März 2024, 20:30 Uhr
Panorama
Der Trabi wurde von vielen Menschen in der DDR mit Hingabe gepflegt, nach der Wiedervereinigung aber gegen andere Modelle getauscht. Inzwischen steigen Zulassungszahlen und Preise wieder.

Zweitakt-Motor mit zunächst 23 PS, Luftkühlung, Maximaltempo 100 und eine Karosse aus Duroplast statt Blech: Vor 60 Jahren präsentierten die VEB Sachsenring Automobilwerke den Trabant 601 auf der Leipziger Frühjahrsmesse der internationalen Öffentlichkeit – neben einem Horch Baujahr 1911, um auf die stolze Autotradition der Region zu verweisen. Vorgänger hatte es gegeben, doch mit mehr als 2,8 Millionen Exemplaren wurde der 601 der meistverkaufte Wagen Trabant und bis 1990 produziert – in pastellblau, polarweiß oder cliffgrün.
Von einer vollkommen neuen Karosserie schwärmt im Frühjahr 1964 das Magazin Der Deutsche Straßenverkehr, einer Karosserie, "die im Stil der modernen Trapezlinie dem internationalen Geschmack entspricht". Im Vergleich zu seinen Vorgängern biete er mehr Kopffreiheit, einen größeren Kofferraum, Kurbelfenster und Druckknopftürgriffe. "Mit dem Platzangebot im Innenraum liegt der Trabant 601 im internationalen Maßstab an der Spitze der vergleichbaren Fahrzeuge", schreibt die DDR-Zeitschrift.
Zwar geht das neue Modell im Juni 1964 in Serie, die Produktion hält aber mit der Nachfrage nie Schritt. Die Folge: Wartezeiten von mehr als zehn Jahren. Das lag auch an Besonderheiten der Karosserie, wie Bernd Cyliax erzählt. Der 79-Jährige arbeitete einst beim VEB Sachsenring. Weil es an Devisen und Rohstoffen fehlte, wurde für die Karosserie Duroplast verwendet. "Duroplast besteht im Prinzip aus Baumwolle, die aus der Sowjetunion kam, und Phenolharz aus Braunkohlenteer." Das Ganze – jeweils zehn Teile je Auto – wurde bei 180 Grad gepresst und musste wieder abkühlen. "So ein Pressvorgang dauerte acht Minuten – das war das Problem", sagt Cyliax.
Dem Trabi brachte diese Eigenheit Kosenamen wie "Plastebomber" oder "Rennpappe" ein. Wegen der langen Wartezeiten waren gebrauchte Fahrzeuge häufig teurer als Neuwagen. Doch wer einen ergattert hatte, für den war er oft ein treuer Begleiter – bis zur Fahrt an die Ostsee, den Balaton in Ungarn oder bei der ersten Stippvisite nach Westdeutschland Ende 1989. Auf den Straßen wich er danach rasch Modellen von Volkswagen, Ford oder Opel.
Gut 30 Jahre später feiert der Stinker ein Comeback und hat Kultstatus – nicht nur in Ostdeutschland. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes. Seit rund zehn Jahren steigt die Zahl der zugelassenen Trabis. Waren es 2014 gut 32.300, wurde im vergangenen Jahr die Marke von 40.000 geknackt – davon knapp 32.000 im Osten und 8300 im Westen.
Wer einen der inzwischen zum Oldtimer geadelten Wagen kaufen will, muss immer mehr Geld hinblättern. Im Schnitt würden sie derzeit für rund 7300 Euro angeboten, sagt Gerd Heinemann vom Beratungsunternehmen BBE Automotive. Es erstellt Marktanalysen für Old- und Youngtimer. Für besondere Varianten werden gar Preise von 25.000 Euro und mehr verlangt. "Die Preise werden tendenziell weiter steigen."
Dass es in Deutschland wieder mehr Trabis gibt, sei auch auf Reimporte zurückzuführen, erklärt Heinemann. Aber vor allem die einfache Konstruktion befeuert sein Revival. Denn vieles lässt sich von Hobbyschraubern reparieren und mit vorhandenem Rahmen wird ein Trabant auch schon mal komplett neu aufgebaut.
Als Beleg führt Frank Hofmann über den Hof seines Unternehmens Trabantwelt in Zwickau. Er öffnet das Tor eines Garagencontainers. Darin kommt ein Trabant 601 Kombi in Panamagrün zum Vorschein. "Den hat mein Junior fast komplett neu aufgebaut und ist damit zu seinem Abiball gefahren."

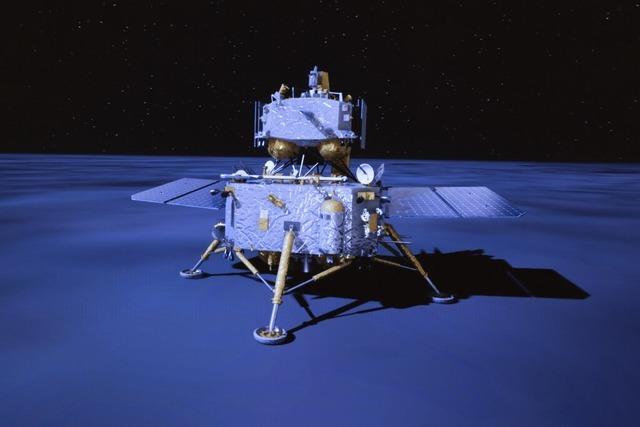










Kommentare
Liebe Leserinnen und Leser,
die Kommentarfunktion ist aktuell geschlossen, es können keine neuen Kommentare veröffentlicht werden.
Öffnungszeiten der Kommentarfunktion:
Montag bis Sonntag 6:00 Uhr - 00:00 Uhr